Fragen zur Erziehung und Entwicklung Ihrer Kinder und zum Familienalltag? Die Fachleute unserer Kinder- und Jugendhilfezentren (kjz) beraten Sie gern.
Zum kjz-Beratungsangebot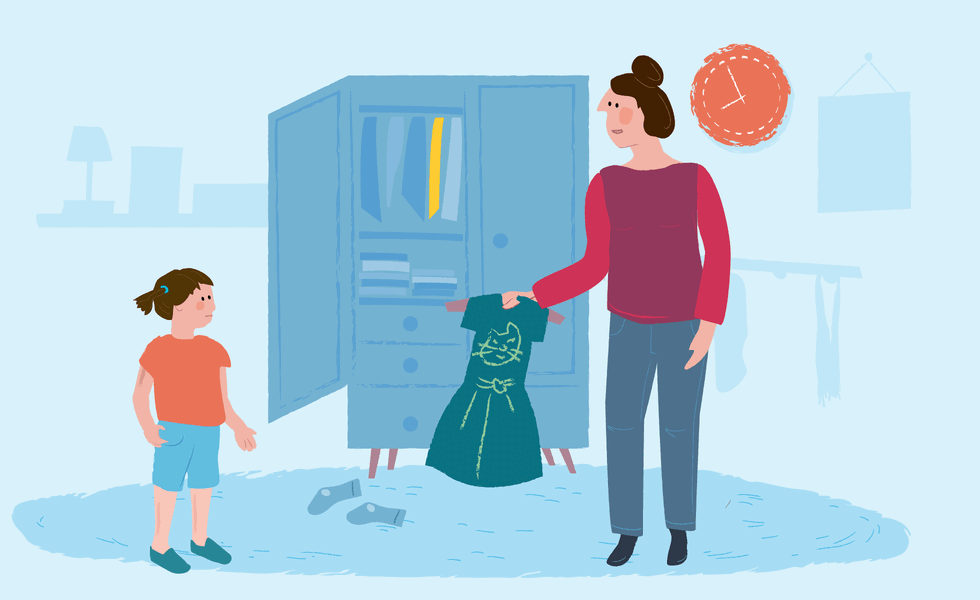
Wenn Kinder Nein sagen und dieses Verhalten sich nicht mit den Vorstellungen ihrer Eltern deckt, beginnt oft ein emotionaler Kraftakt für alle Beteiligten. In unserer vierteiligen Serie beleuchten wir typische Szenen der Autonomiephase. Wir erklären die Situation des Kindes und zeigen, wie Sie als Eltern sinnvoll reagieren.
Was passiert gerade?
Es ist früher Morgen. Die Mutter macht ihre vierjährige Tochter für die Kita parat. Beide stehen vor dem Kleiderschrank im Kinderzimmer. Die Zeit drängt, schliesslich muss die Mutter nach dem Fahrdienst zur Kita schnell ins Büro. Doch das Kleidchen, das sie für ihre Tochter ausgesucht hat, scheint diese nicht zu überzeugen. Sie bringt lautstark zum Ausdruck, dass sie den gelben Pullover anziehen will.
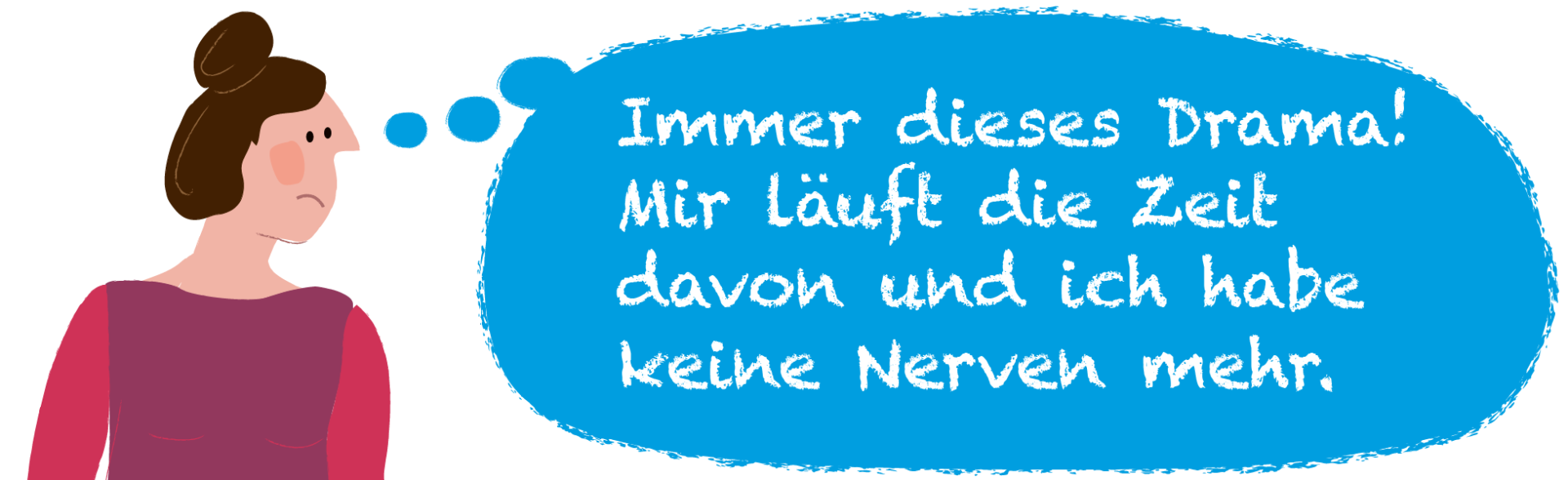
Die Perspektive des Kindes
Das Kind sagt: «Ich will den gelben Pulli anziehen!» Was es aber ausdrücken möchte, ist: «Ich will selbst bestimmen!» In diesem Moment erlebt es einen inneren Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Autonomie und der noch begrenzten Fähigkeit zur Impulskontrolle. Das Kind will ernst genommen und gehört werden, will eigene Entscheidungen treffen, kann die eigenen Emotionen aber noch nicht gut regulieren, wenn es auf Widerstand oder Grenzen stösst. Die Reaktion des Kindes ist kein bewusstes böses Verhalten, sondern Ausdruck von emotionaler Überforderung.
Weshalb reagiert das Kind so?
- Wunsch nach Selbstständigkeit
In der Autonomiephase entwickeln Kinder den Willen, Entscheide selbst zu treffen. Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Kleidung ist ein Bereich, in dem Kinder besonders gern selbst bestimmen, weil er greifbar und konkret ist. - Frustration über mangelnde Kontrolle
Wenn Eltern entscheiden, was das Kind anziehen soll, empfindet es das Kind als Kontrollverlust – auch wenn dies aus der Sicht der Erwachsenen völlig harmlos erscheint. - Zeitdruck
Kinder spüren, wenn Eltern gestresst sind – und das überträgt sich. Der Wunsch des Kindes, sich selbst zu behaupten, trifft dann auf die Ungeduld der Erwachsenen, wodurch eine Reibungsfläche entsteht. - Unausgereifte emotionale Regulation
Ein vierjähriges Kind kann starke Gefühle wie Frust, Ärger oder Enttäuschung noch nicht in Worte fassen oder ruhig verarbeiten. Daher zeigt es sie körperlich und laut.
Wie Sie als Eltern reagieren könnten
- Geben Sie dem Kind eine Wahlmöglichkeit.
Bieten Sie Ihrem Kind eine Wahl an: «Willst du das Kleidchen oder den gelben Pulli anziehen?» Das stärkt die Mitbestimmung und verringert den Widerstand. Ist Ihr Kind gestresst, ist eine klare und begründete Entscheidung Ihrerseits manchmal besser. Denn sie gibt Ihrem Kind Orientierung. Auch Pseudo-Verhandlungen wie «Heute entscheidest du, morgen ich» können funktionieren. - Versuchen Sie, Routine beim Anziehen aufzubauen.
Suchen Sie die Kleidung zum Beispiel schon am Vorabend gemeinsam mit dem Kind aus. So können Sie Konflikte im Morgenstress vermeiden. - Bleiben Sie gelassen und begleiten Sie Ihr Kind.
Auch wenn es schwerfällt: Bleiben Sie ruhig und benennen Sie die Geschehnisse: «Du bist wütend, weil du den gelben Pulli anziehen möchtest, ich aber das Kleidchen ausgesucht habe.» So fühlt sich Ihr Kind verstanden und beruhigt sich schneller.




