Bei der Mobilen Intervention bei Jugendkrisen finden Betroffene rasch und unkompliziert Beratung und Unterstützung. Das Team besteht aus erfahrenen Sozialarbeitenden und Psychologinnen und Psychologen. Das Angebot ist kostenlos.
Zum Angebot
Jugendliche müssen viele Herausforderungen bewältigen: hohe Anforderungen in Schule und Gesellschaft, die Schattenseiten der digitalen Welt, und, fast nebenbei noch, alles Neue, was die Pubertät mit sich bringt. Wenn ihnen alles zu viel wird, finden sie aber oft nicht unmittelbar die passende Unterstützung für ihre Situation. Diese Erfahrung musste die Familie von Julia (12) machen, als sie mit der suizidgefährdeten Tochter mehrmals auf sich allein gestellt dastand.
«Ich war so gestresst, so am Anschlag. Irgendwann sagte ich meinem Lehrer, dass ich mich selbst verletzte. Ich musste es einfach jemandem sagen. Mein Lehrer sagte, ich solle mich der Schulpsychologin anvertrauen, und an ihre Worte erinnere ich mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre: Wenn ich mich nun nicht beruhige, müsse ich in die Psychiatrie eingewiesen werden. Das machte mir solche Angst. Zuhause setzten mich meine Eltern wortlos ins Auto. Sie sagten mir nicht, dass wir nun dort hinfahren würden. Ich fühlte mich so hintergangen. Von allen.»
Julia* war damals zwölf Jahre alt und litt in der Schule unter schweren Schikanen. Kinder warfen mit Steinen nach ihr oder versteckten ihre Schuhe auf dem Ameisenhaufen. Julia meldete die Geschehnisse. Doch die Lehrpersonen erkannten ihre Not nicht. Julia zog sich mehr und mehr zurück, suchte andere Wege, um mit den Belastungen umzugehen. Sie begann, sich selbst zu verletzen, verbrachte immer mehr Zeit online. Auf Tiktok führte sie der Algorithmus schliesslich in eine Online-Welt, in der Schmerz und Schweres miteinander geteilt wurde, eine Community mit «kranker Dynamik», wie Julia rückblickend sagt. Die «Bubble» sei zur gefährlichen Echokammer jeglicher negativen Gefühle geworden, habe einander auf einer destruktiven Spirale vorangetrieben. «Es ging darum, wem es am schlechtesten geht», erzählt Julia. «Und wenn es jemandem noch schlechter geht als dir, bist du es nicht wert, dass dir geholfen wird.»
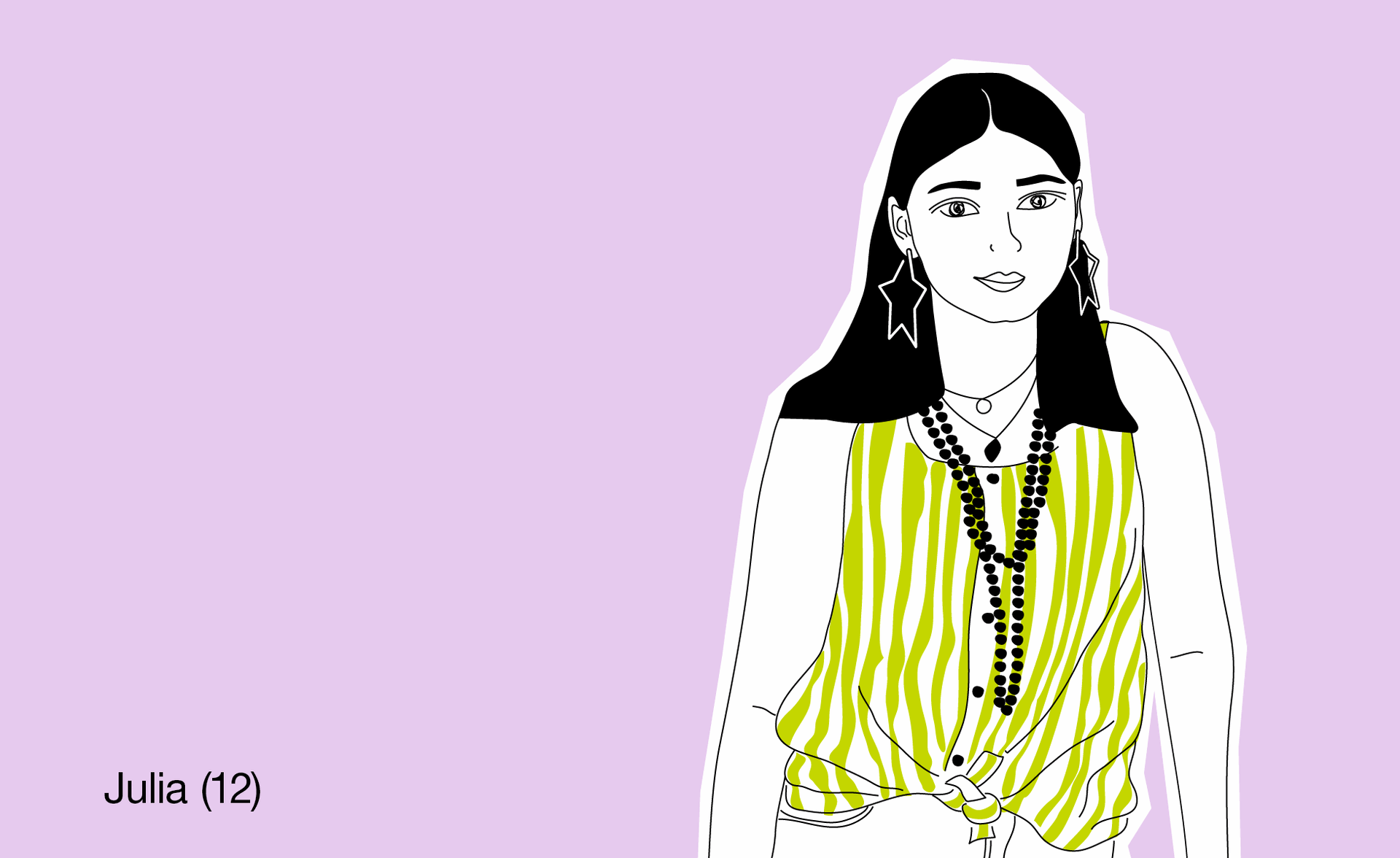
Rückblickend ein Fehler
Julias Eltern merkten zwar, wie sich ihre Tochter immer mehr zurückzog. Die Bildschirmzeit führte entsprechend zu viel Streit. Sie wussten auch von Konflikten in der Schule. Doch Julias Leistungen waren weiterhin gut, täuschten auch über die Belastungen hinweg. «Wir dachten, okay, sie wird jetzt ein Teenager. Wir müssen ihr den Raum lassen, auch selbst etwas aushalten», erzählen die Eltern.
Als die Schule anrief und meldete, Julia sei suizidgefährdet, war das ein Schock. «Es hiess, wenn wir unsere Tochter nicht innert Stunden in die Psychiatrie einwiesen, würden sie die Kindesschutzbehörde einschalten. Da kamen wir nicht auf die Idee, uns erst einmal in Ruhe mit Julia hinzusetzen. Rückblickend war das ein grosser Fehler. Wir waren in solcher Sorge und einfach so überfordert.»
Am Ende eines aufwühlenden Tages stand die Familie schliesslich wieder zuhause. Die Abklärungen in der Klinik ergaben zwar Belastungen, jedoch keine akute Lebensgefährdung.
Auffangnetze mit Lücken
So wie Julias Eltern ergeht es vielen Familien mit Jugendlichen, die in eine Krise geraten. Vieles spielt in der Pubertät zusammen, die Anforderungen nehmen zu: Die Heranwachsenden möchten sich finden, unabhängig werden, aber auch gefallen. Das kann ganz neue Gefühle von Unsicherheit, Angst und Enttäuschung auslösen. Gleichzeitig gehört es zur gesunden Entwicklung dazu, sich von den Eltern zurückzuziehen, sich auch mit ihnen zu reiben. Zu wissen, was alarmieren muss und was nicht, kann für Eltern zur grossen Herausforderung werden. Gerade Äusserungen von Suizidgedanken können enorm belasten und ohne fachliche Unterstützung an die Grenzen bringen. Gleichzeitig sind Notfallstellen vielfach massiv überlastet und müssen sich auf dringendste Gefährdungen konzentrieren. Während die vermeintlichen Hilfsforen in den Sozialen Medien eine mächtige Parallelwelt bilden können.
«Ich kann nicht mehr»
Über persönliche Kontakte schafften es die Eltern schliesslich, Julia an eine Psychologin zu vermitteln. Doch Julias Vertrauen war nach dem Erlebten schwer angeschlagen. Sie machte zu, versuchte, mit ihren Belastungen wieder allein umzugehen, verletzte sich weiter selbst. Zurück in der Schule schlug sie sich zwar durch, schaffte gar den Wechsel ans Gymnasium. Der neue Leistungsdruck und der Streit zuhause belasteten sie aber mehr und mehr und sie begann, ihre Aussenwelt immer dunkler wahrzunehmen. Eines Tages merkte sie: Es ist zu viel. Ohne Hilfe kann ich nicht mehr.
Julia zwang sich, sich noch einmal zu öffnen und ihrer Therapeutin von ihren Suizidgedanken zu erzählen. Diesmal gelang das Zusammenspiel. Die beiden besprachen gemeinsam, dass nichts falsch war, an dem, was sie sagte, solche Gedanken aber zu belastend sind, um sie allein bewältigen zu können. Und vor allen Dingen: Wie es von grosser Stärke zeugt, um Hilfe zu fragen. Und wie wichtig es ist, gute Hilfe zu bekommen. Daraufhin verbrachte Julia drei Monate in einer Klinik.
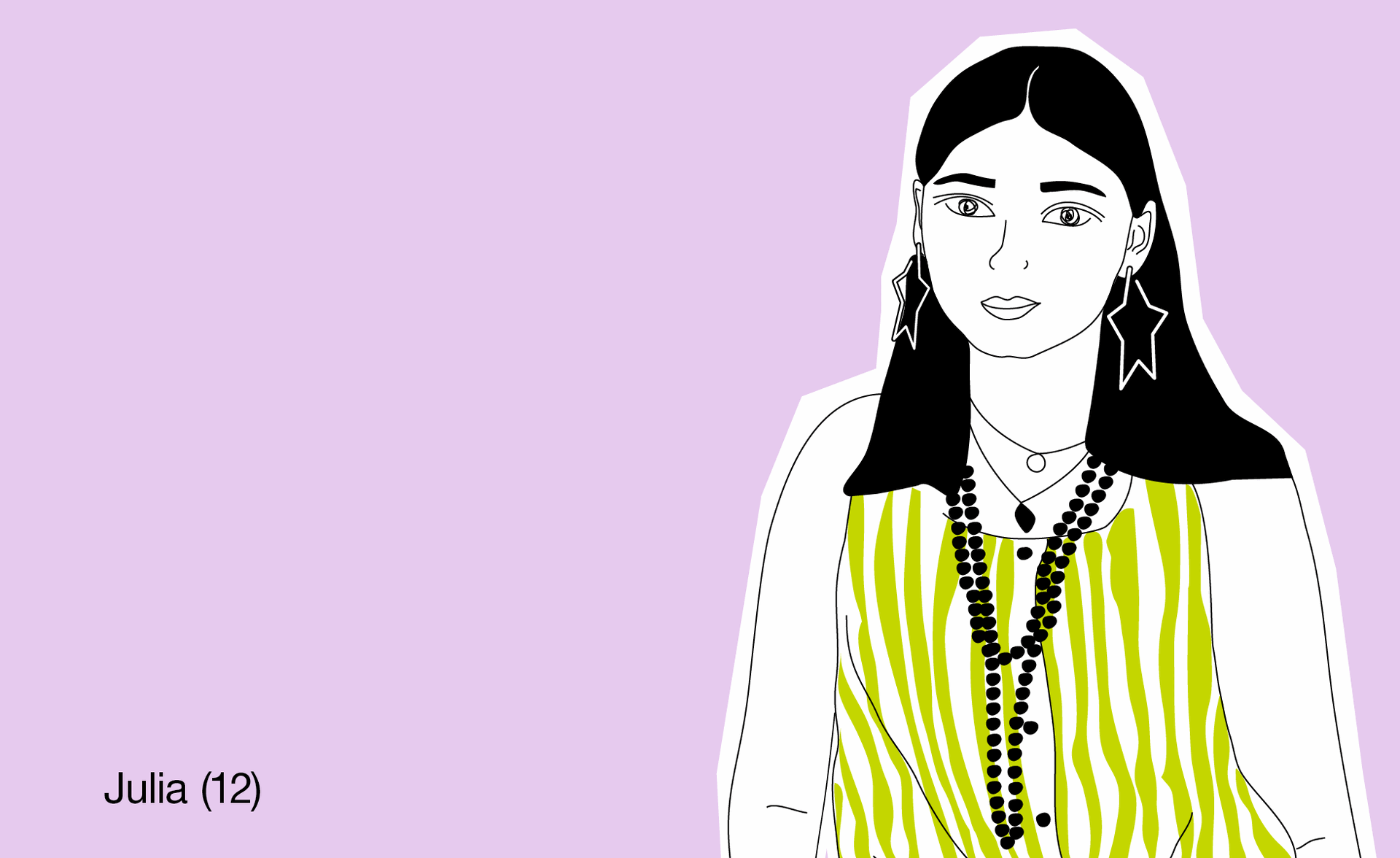
Nach 90 Tagen im Alltag zurechtfinden
Der Tapetenwechsel sei wichtig für sie gewesen, sagt Julia rückblickend. Allerdings sind Klinikaufenthalte beschränkt, in Julias Klinik auf 90 Tage. Danach gilt es, sich wieder im Alltag zurechtzufinden. «Man meint, die Welt sei wieder gut, wenn das Kind nach Hause kommt», erzählt Julias Vater. «Doch eigentlich beginnt der Weg erst da.» Hinzu kam: Das Angebot, mit welchem Julia bei ihrem Austritt hätte begleitet werden sollen, wurde kurz darauf eingestellt. Und eine Alternative war gerade nicht verfügbar. Ein zweites Mal standen die Eltern allein mit Julia da.
«Man läuft wie im Nebel, ruft Dutzende Leute an, muss wieder von vorne beginnen, seinen Fall erklären, Formulare ausfüllen», erzählt ihr Vater. «Als Eltern ist man völlig fertig.» Julias Mutter ergänzt: «Wir mussten immer wieder aufs Neue beweisen, dass wir bemühte Eltern sind, unsere Tochter lieben und sie unterstützen wollen. Dass wir selbst fast zusammenbrachen und auch noch einen jüngeren Sohn haben, interessierte niemanden. Ich wäre kaputtgegangen, wären mein Mann und ich nicht so ein starkes Team.»
Die Erwartungen nicht erfüllt
Wie wichtig eine gute Begleitung nach psychischen Belastungen wäre und wie viel Wissen im Umgang damit in der Gesellschaft noch fehlt, zeigen Julias Erfahrungen zurück im Alltag: Sie schaffte zwar den Wiedereinstieg am Gymnasium. Doch schien es den Lehrpersonen an Erfahrung mit der Situation zu fehlen. «Ich hätte vor der ganzen Klasse erzählen sollen, wo ich war, im Musikunterricht vor allen vorsingen müssen», erzählt sie. «Das war alles wieder so ein Stress für mich.» Als Julia nicht auf Anhieb gute Noten schrieb, hiess es schliesslich: Zu lange gefehlt, zu schlechte Noten, Probezeit nicht bestanden. Aufgrund ihrer Erkrankung zweifelten die Lehrpersonen daran, dass sie die Leistung zukünftig erbringen könne. Eine zweite Chance bekam Julia nicht. Doch wie geht es nach einem Verweis vom Gymnasium schulisch weiter? Mit dieser Frage fühlte sich die Familie erneut alleine.
Die Beziehung zum Kind über alles stellen
Schliesslich gelangte die Familie an die Anlaufstelle «Mobile Intervention bei Jugendkrisen», ein Angebot, das bei Zuständigkeitslücken beigezogen werden kann. Die Fachpersonen können die Familien zum Beispiel zuhause besuchen, vermitteln zwischen den Beteiligten, zeigen Möglichkeiten auf oder leisten Aufklärungsarbeit. «Zum ersten Mal fühlten wir uns als ganze Familie gesehen», erzählen Julias Eltern.
In gemeinsamen Gesprächen konnten sie Abstand nehmen, den Fokus ganz auf die Familie richten und sich fragen, wofür kämpfen wir hier eigentlich? «Plötzlich sahen wir in solch einer Klarheit: Die Therapien und Institutionen, die Pubertät, der Druck von der Schule – all das, was uns so belastete und beschäftigte, ist nur vorübergehend. Die Beziehung zu Julia dagegen soll ein Leben lang halten. Sie ist und bleibt das Wichtigste, was wir haben.»
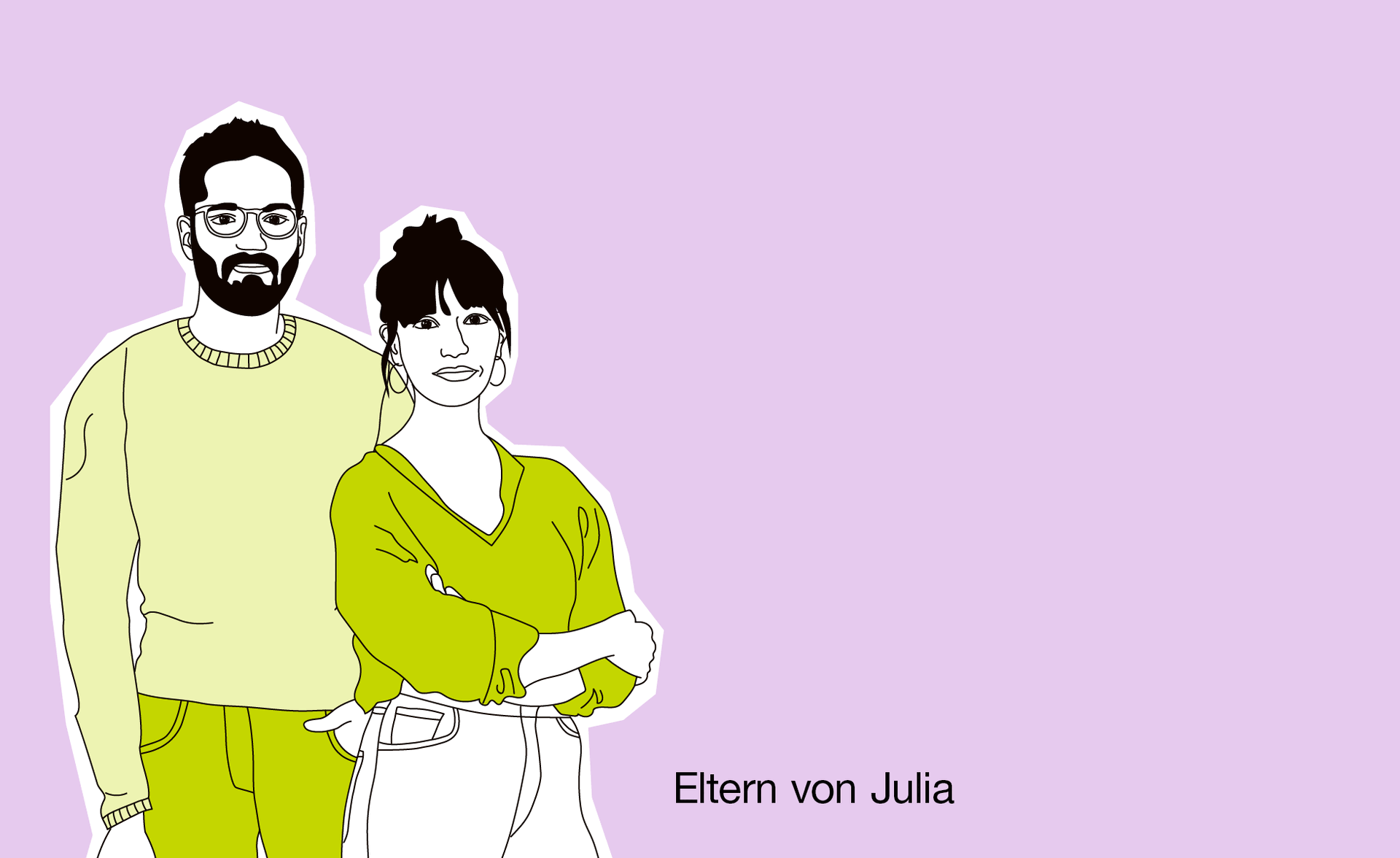
Als Familie konnten sie so eine neue Haltung entwickeln: Entscheidend ist allein, dass es Julia wieder gut geht. Fortan stellten die Eltern die Beziehung zum Kind über alles, besprachen jeden weiteren Schritt als Familie. Gemeinsam reichten sie Rekurs ein gegen den Verweis vom Gymnasium. Denn Julia hätte bleiben wollen. Eine Chance bekommen wollen, zu zeigen, was sie kann, wenn sie gesund ist.
Der Entscheid von oberster Stelle lautete schliesslich: Eine psychische Erkrankung sei kein rechtmässiger Grund für einen Schulausschluss. Julia erhalte freie Wahl für einen Neuanfang an allen Gymnasien im Kanton.
Neuanfang – durch neues Selbstverständnis
Zwei Jahre später wirkt Julia geerdet. Dass sie in ihrem jungen Leben schon mit viel Belastung umzugehen lernen musste, wird in ihren Erzählungen spürbar. Gleichzeitig witzelt sie entspannt mit ihren Eltern. Wie sie da miteinander sitzen, erweckt es den Eindruck eines ganz besonderen Zusammenhalts. Einer Art Neuordnung aus der Not, einer Frische und Ruhe wie nach einem schweren Sturm. An ihrer neuen Schule sei es ein ganz anderes Gefühl, erzählt Julia. Sie fühle sich von den Lehrpersonen unterstützt. Entscheidend sei aber der innere Prozess, den sie durchgemacht habe: «Durch die Therapien habe ich ein tieferes Selbstverständnis entwickelt. Ich weiss nun besser, wer ich bin und warum ich fühle, wie ich fühle.
Und Tiktok? Julia lacht. «Tiktok ist weit in den Hintergrund gerückt. Und der Algorithmus hat unterdessen gemerkt, dass ich an anderen Inhalten hängen bleibe. Inzwischen schaue ich Katzenvideos.»
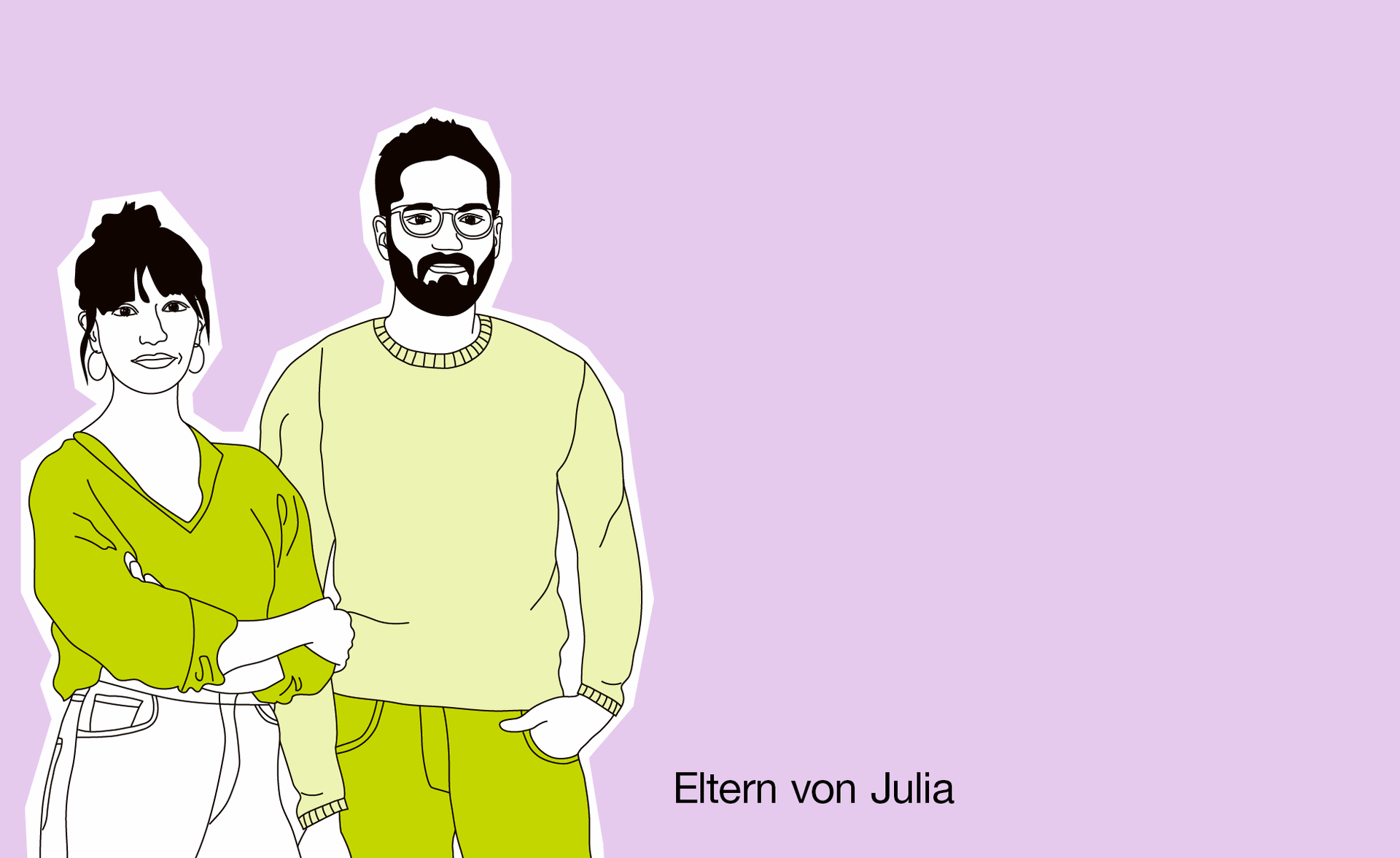
* Name durch die Redaktion geändert
Sie brauchen Unterstützung?
Julia ist nicht die einzige Jugendliche mit Suizidgedanken. Wenn Eltern diese Gedanken hören, ist die Belastung für sie enorm. Damit solche Gedanken und Gefühle eingeordnet werden können, ist es wichtig, mit den Jugendlichen im Austausch zu bleiben und wenn nötig fachliche Unterstützung zu holen.
Bei akuten Suizidgedanken, wenden Sie sich direkt an die Notfallstelle für Kinder und Jugendliche der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Die Fachpersonen sind täglich und jederzeit erreichbar unter: Tel. 058 384 66 66
Bei der Anlaufstelle «Mobile Intervention bei Jugendkrisen» finden Betroffene rasch und unkompliziert Beratung und Unterstützung. Das Team besteht aus erfahrenen Sozialarbeitenden und Psychologinnen und Psychologen. Das Angebot ist kostenlos.

Fragen zur Erziehung und Entwicklung Ihrer Kinder und zum Familienalltag? Die Fachleute unserer Kinder- und Jugendhilfezentren (kjz) beraten Sie gern.
Zum kjz-Beratungsangebot



